Wählen heißt nicht immer: frei sein
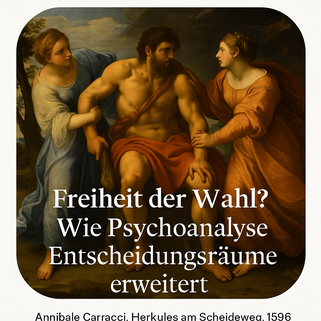
In unserer Kultur gilt Wahlfreiheit als Inbegriff von Autonomie. Wer entscheiden kann, ist frei – so die Logik. Doch psychoanalytisch betrachtet beginnt hier bereits das Missverständnis. Denn der Mensch „entscheidet“ sich oft nicht, er wiederholt. Und was wiederholt wird, ist meist nicht bewusst gewählt – sondern tief in der frühen Subjektgeschichte verankert.
Freud nennt das die Objektwahl: jenes unbewusste Muster, nach dem wir unsere Beziehungen, unsere Partner, unsere Berufe – kurz: die zentralen Bezugspunkte unseres Begehrens – immer wieder ähnlich strukturieren. Nicht, weil wir es so wollen. Sondern, weil es uns so geworden ist.
„Der Mensch wählt sein Liebesobjekt nicht frei, sondern nach dem Vorbild seiner ersten Beziehungen.“
— Sigmund Freud, Zur Einführung des Narzißmus (1914), GW X, S. 162
Objektwahl: Was unser Begehren strukturiert
Die psychoanalytische Theorie der Objektwahl unterscheidet zwischen der anaclitischen Wahl, die auf frühe Abhängigkeitserfahrungen mit Bezugspersonen zurückgeht, und der narzisstischen Wahl, bei der sich das Subjekt in einem anderen wiederzuerkennen sucht – in dessen Idealen, Schwächen oder Verletzungen.
Diese Muster wirken im Unbewussten fort und strukturieren nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch das, was wir im Beruf, in der Freizeit, im Konsum oder in der Therapie suchen. Sie bestimmen, was wir als möglich oder unmöglich erleben – lange bevor ein bewusster Entschluss gefasst wird.
Der Zwang zu wählen – und doch nicht zu entscheiden
Gerade die Zwangsneurose zeigt, wie unbewusste Konflikte die scheinbare Freiheit blockieren. Menschen, die darunter leiden, zögern Entscheidungen hinaus, vermeiden Alternativen oder wiederholen in immer neuen Varianten dieselbe Verstrickung.
Freud beschreibt in Zwangshandlungen und Religionsübungen (1907), wie Zwänge Halt geben, wo Entscheidungsfähigkeit fehlt. Das Ich klammert sich an Rituale, Regeln, Verbote – als ob sich die Angst dadurch bannen ließe. Doch das Ergebnis ist eine Paradoxie: maximale Kontrolle bei minimaler Freiheit.
„Der Zwangskranke benimmt sich, als wäre er vor eine Wahl gestellt – aber er ist es nicht.“
— Sigmund Freud, Zwangshandlungen und Religionsübungen (1907), GW VII
Psychotherapie: Ein Raum jenseits der Wiederholung
Die psychoanalytische Praxis ist kein Ort der Entscheidungshilfe im herkömmlichen Sinn. Sie arbeitet nicht mit Tipps, Ratschlägen oder Zielvereinbarungen. Ihr Ansatz ist tiefer – und oft überraschender: Sie schafft einen Raum, in dem das Subjekt seiner eigenen Sprache begegnet.
Denn dort, wo bisher Wiederholung herrschte, kann – durch Analyse, durch Übertragung, durch Arbeit am Begehren – ein neues Verhältnis zu sich selbst entstehen.
„Wo Es war, soll Ich werden.“
— Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1933), GW XV, S. 89
Dieses oft zitierte Wort meint nicht Beherrschung des Unbewussten, sondern das langsame Erkennen der Struktur, die Entscheidungen bisher unmöglich gemacht hat. Erst wer diese Struktur versteht, kann anders wählen.
Psychoanalyse erweitert den Möglichkeitsraum
In meiner eigenen Arbeit – mit Patienten, Analysanten, Paaren oder Führungskräften – zeigt sich immer wieder: Wahlfreiheit entsteht nicht durch Optionen, sondern durch Einsicht.
In einem Kapitel meines Buchs Arbeitsplätze sind Beziehungsplätze (Springer, 2023) habe ich geschrieben:
„Der Entscheidungsraum öffnet sich nicht durch Willenskraft, sondern durch das Verstummen der inneren Wiederholung.“
— Moritz Senarclens de Grancy
Das gilt nicht nur für Organisationen – sondern auch für Einzelne, die ihre Lebensentscheidungen neu denken wollen: Beziehung oder Trennung? Berufswechsel oder Bleiben? Nähe oder Rückzug? In all diesen Fragen ist der entscheidende Schritt, sich zu fragen: Wer entscheidet hier eigentlich in mir?
Zusammenfassung
Wahlfreiheit ist psychoanalytisch keine Frage der Alternativen, sondern der unbewussten Bindungen.
Eine Psychoanalyse oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie kann helfen, die Muster der Objektwahl zu erkennen und den Raum zu öffnen für echte Entscheidungen – jenseits von Angst, Wiederholung und innerem Zwang.
Wer sich selbst zuhört, kann mit der Zeit auch sich selbst anders wählen.
Interessiert an Psychoanalyse oder psychodynamischer Psychotherapie?
Ich biete in meiner Praxis in Berlin-Mitte analytische Einzeltherapie, Beratung, Paartherapie und Supervision an – auf Deutsch oder Englisch, in Präsenz oder online.
Literatur (Auswahl):
-
Freud, S. (1907): Zwangshandlungen und Religionsübungen, GW VII
-
Freud, S. (1914): Zur Einführung des Narzißmus, GW X
-
Freud, S. (1933): Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, GW XV
-
Senarclens de Grancy, M. (2025): Arbeitsplätze sind Beziehungsplätze, Springer
